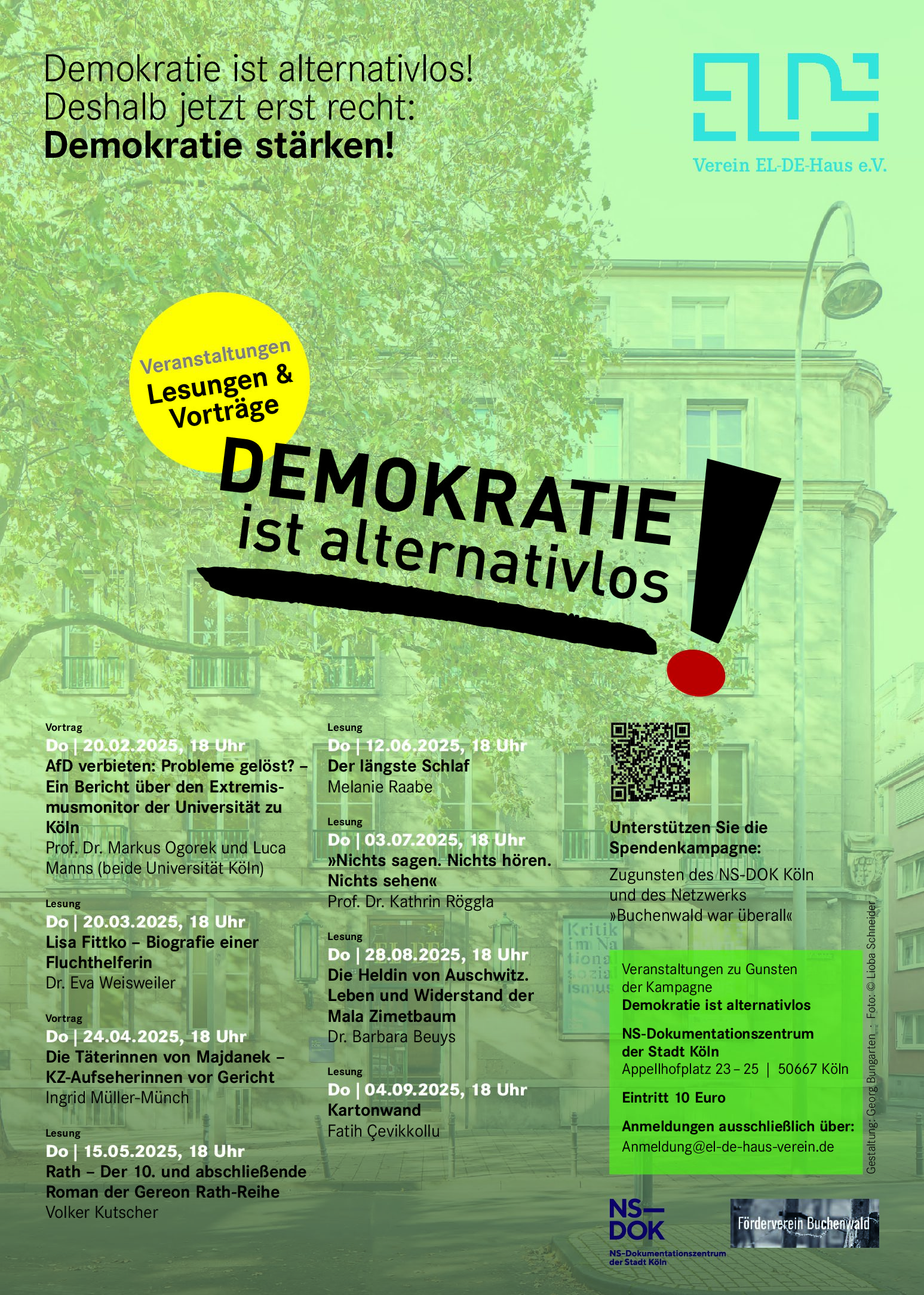Autor: admin (Seite 1 von 2)
Beitrag Jens-Christian Wagners vom 1.2.2025
Der 29. Januar 2025 wird in die Geschichtsbücher eingehen. Es ist der Tag, an dem konservative Parteien zum ersten Mal offen mit Rechtsextremen zusammengearbeitet haben. Ganz bewusst verließ sich die CDU/CSU-Bundesfraktion auf die Zustimmung der AFD um für ihren Entschließungsantrag zur Begrenzung der Migration eine Mehrheit im Bundestag zu erhalten. Die Brandmauer zu den Rechtsextremen ist damit gefallen. Und die FDP machte dabei mit.
Partei-Funktionäre reden NS-Verbrechen klein
Seit Jahren beobachten die Gedenkstätten eine deutliche Zunahme von Angriffen und Anfeindungen durch extrem Rechte und eine zunehmende Verbreitung holocaustverharmlosender Positionen. Die Verantwortung für diese Entwicklung liegt aber nicht nur bei anonymer Internetpropaganda, sondern auch bei politischen Akteuren, die geschichtsrevisionistische Mythen aktiv verbreiten und die Gedenkstättenarbeit anfeinden. Das gilt vor allem für die AfD. Letztere ist sowohl Symptom als auch Motor dieser Entwicklung. Ständig reden Funktionäre der AfD die NS-Verbrechen klein, relativieren sie oder betreiben Schuldumkehr, wenn sie die Alliierten als die eigentlichen Kriegsverbrecher bezeichnen.
Das machte etwa der Thüringer AfD-Landtagsabgeordnete Jörg Prophet, dessen Wahl zum Landtags-Vizepräsidenten am Donnerstag nur knapp scheiterte und der den britischen Luftangriff auf Dresden mit Auschwitz gleichsetzte, den amerikanischen Befreiern des KZ Mittelbau-Dora „Morallosigkeit“ vorwarf sowie vom „Schuldkult“ sprach und mit Geraune über den Morgenthau-Plan und die angeblichen Verbrechen in den Rheinwiesenlagern antisemitisch aufgeladene Legenden verbreitete.
AfD stellt positive Bezüge zum Nationalsozialismus her
Sein Thüringer Parteichef Höcke wiederum forderte eine „erinnerungspolitische Wende um 180 Grad“, und der AfD-Bundes-Ehrenvorsitzende Gauland bezeichnete die NS-Zeit in einer Rede in Thüringen als „Vogelschiss in über 1000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte“. Der AfD-Europa-Spitzenkandidat Maximilian Krah ließ im Wahlkampf 2024 kaum eine Gelegenheit aus, die Wehrmachtsverbrechen zu leugnen und die SS zu verharmlosen.
Und nicht nur NS-Verharmlosung betreibt die AfD, sondern sie setzt zunehmend auch positive Bezüge zum Nationalsozialismus, wenn sie sich in ihrem Landtagswahlprogramm für Thüringen auf den radikalen Hitler-Bewunderer und Antisemiten Franz Langheinrich beruft oder Björn Höcke behauptet, Europa werde von „raumfremden Mächten“ regiert, ein Begriff, den der NS-Staatsrechtler Carl Schmitt 1941 prägte. Mehrere AfD-Mandatsträger nutzten zudem den Volkstrauertag 2024, um Täter-Opfer-Umkehr zu betreiben und den von den Nationalsozialisten eingeführten Begriff des „Heldengedenktages“ wiederaufleben zu lassen.
Tag der Schande für die Union
Besonders alarmierend ist, dass diese Aussagen nicht nur im politischen Raum, sondern durch AfD-Abgeordnete auch aus den Parlamenten heraus verbreitet werden. Das verleiht ihnen eine scheinbare demokratische Legitimation und beschleunigt ihre Verbreitung im öffentlichen Raum. Zudem können sich dadurch gewaltbereite Neonazis ermutigt fühlen, in den Gedenkstätten zur Tat zu schreiten. Die Zunahme von Angriffen auf die Gedenkstätten zeigt das deutlich.
Jahrzehntelang war es demokratischer Konsens in der Bundesrepublik, dass man mit extrem Rechten nicht zusammenarbeitet. Diesen Konsens haben CDU/CSU in dieser Woche aufgekündigt – und das nur wenige Stunden nach der Gedenkveranstaltung des Bundestages für die Opfer des Nationalsozialismus. Albrecht Weinberg, Überlebender von Auschwitz, Mittelbau-Dora und Bergen-Belsen, hat angekündigt, sein Bundesverdienstkreuz zurückzugeben. Ein Tag der Schande für die Union.
Der Historiker Jens-Christian Wagner ist Professor für Geschichte an der Universität Jena und Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora.
Internationales Kommitee Buchenwald–Dora und Kommandos
Aufruf an alle Abgeordneten des Thüringer Landtages vom 24.01.2025
Mit einem dringenden Appell wendet sich das Internationale Komitee Buchenwald-Dora und Kommandos (IKBD), in dem sich Überlebende der beiden Konzentrationslager und ihre Angehörigen aus zahlreichen Ländern zusammengeschlossen haben, an die Abgeordneten des Thüringer Landtages: Es ruft sie auf, den als Geschichtsrevisionisten und Holocaust-Verharmloser bekannten AfD-Abgeordneten Jörg Prophet nicht zum Vizepräsidenten des Thüringer Landtages zu wählen.
„In Thüringen bahnt sich ein handfester geschichtspolitischer Skandal an“, sagt dazu Stiftungsdirektor Jens-Christian Wagner. „Ausgerechnet im unmittelbaren Anschluss an die Gedenkstunde des Landtags am 29. Januar 2025 zum Internationalen Holocaust-Gedenktag soll jemand zu seinem Vizepräsidenten gewählt werden, der die NS-Verbrechen wiederholt verharmlost hat – für die Überlebenden des NS-Terrors ein unerträglicher Gedanke, und das nicht nur wegen des zeitlichen Zusammenhangs.“
Der Nordhäuser AfD-Landtagsabgeordnete Jörg Prophet ist in den vergangenen Jahren mehrfach mit geschichtsrevisionistischen und den Holocaust verharmlosenden Positionen aufgefallen.
Nachfolgend dokumentieren wir den Aufruf des Internationalen Komitees vom 23. Januar 2025:
Ein Verharmloser der NS-Verbrechen darf nicht Vizepräsident des Thüringer Landtages sein!
Mit Empörung und großer Sorge blicken die Überlebenden der Konzentrationslager Buchenwald und Mittelbau-Dora sowie ihre Angehörigen nach Thüringen. Dass dort mit dem AfD-Landtagsabgeordneten Jörg Prophet ein einschlägig bekannter Geschichtsrevisionist und Holocaust-Verharmloser zum Landtagsvizepräsidenten gewählt werden soll – und das ausgerechnet im Anschluss an die Gedenkstunde des Landtages und der Landesregierung zum internationalen Holocaust-Gedenktag – erschüttert uns zutiefst.
Jörg Prophet hat sich in den vergangenen Jahren mehrfach öffentlich mit den Holocaust verharmlosenden und geschichtsrevisionistischen Positionen hervorgetan, in dem er beispielsweise den U.S.-amerikanischen Befreiern des KZ Mittelbau-Dora „Morallosigkeit“ vorwarf oder den industriellen Massenmord in Auschwitz mit den britischen Luftangriffen auf Dresden im Februar 1945 gleichsetzte. Er verbreitet unter Rechtsextremen häufig genutzte Geschichtslegenden, bezeichnet Nazis als „linke Sozialisten“ und nutzt die von der AfD (und vormals von der NPD) häufig verwendete Redewendung eines angeblichen „Schuldkults“, durch die die Erinnerung an das Leiden unserer Kameraden und Angehörigen massiv diskreditiert wird. Ein Beitrag Prophets wurde sogar (ohne dass sein Autor namentlich erwähnt wurde) in den Thüringer Verfassungsschutzbericht 2021 aufgenommen, der zu dem Schluss kommt, der Autor verfüge über ein „geschlossenes geschichtsrevisionistisches Weltbild“.
In den letzten Jahrzehnten wurde von politisch Verantwortlichen Thüringens immer wieder deutlich gemacht, dass die Erinnerung an die nationalsozialistischen Verbrechen grundlegend für die demokratische Kultur Thüringens ist. Der Thüringer Landtag und der*die jeweilige Ministerpräsident*in haben maßgeblich dazu beigetragen, ein gutes Zusammenwirken zwischen der politischen Ebene, dem IKBD und unzähligen weiteren Menschen in Thüringen, die sich für die Würdigung der Opfer des NS-Terrors engagieren, möglich zu machen. Die bisher regelmäßige Einladung unseres Komitees zur Gedenkstunde am 27. Januar war nur ein Beispiel für dieses Zusammenwirken.
Als Komitee, welches auch weiterhin das Andenken an die Opfer der Verbrechen der Nationalsozialisten bewahrt, bedauern wir zutiefst, dass diese in den vergangenen Jahrzehnten entstandene enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit des IKBD mit den staatlichen Institutionen Thüringens durch die Kandidatur Jörg Prophets nunmehr stark bedroht ist. Sollte dem Landtag ein einschlägig als Geschichtsrevisionist bekannter Politiker als Vizepräsident vorstehen, wäre das ein schwerer Schlag gegen unsere enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Mehr noch: Es wäre ein schwerer Schlag gegen die aufgeklärte, kritische Auseinandersetzung mit den NS-Verbrechen und gegen die Würdigung der Opfer des Nationalsozialismus. Unter einem Vizepräsidenten Prophet wäre uns eine Teilnahme an Gedenkveranstaltungen im Thüringer Landtag nicht vorstellbar.
Wir rufen alle Abgeordneten des Thüringer Landtages dazu auf, sich ihrer geschichtlichen Verantwortung bewusst zu sein und den skizzierten Schaden für den Freistaat Thüringen noch abzuwenden.
Naftali Fürst (Haifa, Israel)
Präsident des Internationalen Komitees Buchenwald-Dora und Kommandos (IKBD), ehemaliger Häftling der KZ Auschwitz und Buchenwald
Jens-Christian Wagner im Kölner Stadtanzeiger vom 21.12.2024
Auf den Nationalsozialismus bezogener Geschichtsrevisionismus ist kein neues Phänomen. Schon vor 1945 verbreiteten die Nationalsozialisten schuld-umkehrende Legenden, sprachen von jüdischen Vernichtungsplänen gegenüber Deutschland oder davon, dass für den Zweiten Weltkrieg wahlweise die Juden, die Briten, die Polen oder die Sowjetunion verantwortlich seien. Nach dem Krieg wärmten ehemalige Nazis und neue Rechtsextreme diese Legenden auf.
Ziel solcher Legenden war und ist es, die deutsche Geschichte in eine Erfolgsgeschichte umzudeuten und die Verbrechen des Nationalsozialismus (wie auch des deutschen Kolonialismus) kleinzureden, zu verharmlosen und zu relativieren oder eine Schuldumkehr zu betreiben, indem die Alliierten (oder auch jüdische Verschwörer) als die eigentlichen Kriegsverbrecher und Schuldigen dargestellt werden. Wer Nationalismus und Stolz auf die deutsche Geschichte propagiert, muss versuchen, sie vom Makel der NS-Verbrechen zu befreien, sie gewissermaßen zu entkriminalisieren. Oder man schiebt sie anderen in die Schuhe. So behaupten Rechtsextreme neuerdings, die Nazis seien in Wirklichkeit Linke gewesen, schließlich nannten sie sich ja National-„Sozialisten“. Auf diese Weise versuchen sie, rechtsextremes Denken vom Stigma Auschwitz zu befreien.
In jüngster Zeit hat sich dieser Trend verstärkt. Im Zuge digitaler Desinformation flutet eine neue Welle geschichtsrevisionistischer Mythen die sozialen Medien. Was früher nur bei obskuren Verlagen mit Postfachadressen verfügbar war, ist heute nur einen Mausklick entfernt. In Foren, Blogs und sozialen Netzwerken kursieren Holocaust-verharmlosende und NS-verherrlichende Inhalte, die mit alarmierender Geschwindigkeit viral gehen. Und es bleibt nicht bei digitalen Angriffen auf die Erinnerungskultur: Immer öfter melden Gedenkstätten Schmierereien mit rechtsextremen Inhalten auf Info- oder Gedenktafeln. Besonders fassungslos macht, dass in Weimar in den vergangenen Jahren rund 50 Bäume abgesägt wurden, die an Häftlinge des KZ Buchenwald erinnern.
Die Verantwortung für diese Entwicklung liegt nicht nur bei anonymer Internetpropaganda, sondern auch bei politischen Akteuren, die geschichtsrevisionistische Mythen aktiv verbreiten und die Gedenkstättenarbeit anfeinden. Das gilt vor allem für die die rechtsoffene bis rechtsextreme Mischszene aus Reichsbürgern, „Montagsdemonstranten“, Identitären, Pandemieleugnern, Putin-Anhängern wie auch die Neue und die Alte Rechte – und für die AfD. Letztere ist sowohl Symptom als auch Motor dieser Entwicklung. Wiederholt hat sie sich durch geschichtsrevisionistische Parolen hervorgetan.
Ein prominentes Beispiel ist der AfD-Politiker Jörg Prophet. Er diskreditierte die Gedenkstättenarbeit als „Schuldkult“, setzte die britischen Luftangriffe auf Dresden im Februar 1945 mit dem Judenmord in Auschwitz gleich und raunte von deutschen Opfern in den Rheinwiesenlagern. Wenn solche Thesen aus den Parlamenten heraus verbreitet werden, verleiht ihnen das eine scheinbare demokratische Legitimation.
Häufig werden geschichtsrevisionistische Mythen, Chiffren und Signalwörter von Menschen außerhalb des Milieus gar nicht in ihrer Bedeutung erkannt – oft, weil das historische Wissen nicht vorhanden ist. Geschichtsrevisionistische Mythen können sich so ungehindert verbreiten; entsprechende Narrative werden zunehmend normalisiert. Hier setzt das Projekt „Geschichte statt Mythen“ der Uni Jena und der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora an. Es verbindet Forschung mit historisch-politischer Bildung: Systematisch werden durch das Monitoring von Reden, Publikationen und Social-Media-Posts geschichtsrevisionistische Positionen in der rechtsextremen und rechtsoffenen Mischszene in Thüringen erfasst und die Argumentationsmuster ausgewertet.
Dabei fragt das Projekt auch nach dem Fortwirken geschichtspolitischer Positionen der SED-Propaganda. Die Ergebnisse werden fortlaufend in einem Blog veröffentlicht. Darin werden nicht nur die gängigen geschichts-revisionistischen Legenden vorgestellt, sondern es wird auch deutlich gemacht, wer sie mit welchen Mitteln und zu welchem Zweck verbreitet. Einträge finden sich etwa zu den AfD-Politikern Björn Höcke und Jörg Prophet, aber auch zu Erinnerungsorten der Neuen Rechten wie der „Gedächtnisstätte Guthmannshausen“, die Geschichtsrevisionismus mit Ahnen-Esoterik verbindet.
Der Blog richtet sich an die allgemeine Öffentlichkeit, bietet aber sicherlich auch Fachleuten neue Informationen. Gefördert wird das Projekt von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft, leider vorerst nur bis April 2025. Es ist zu hoffen, dass sich eine Anschlussfinanzierung findet, denn es ist kaum zu erwarten, dass der Geschichtsrevisionismus im Frühjahr 2025 urplötzlich von der Bildfläche verschwindet. Es liegt in der Verantwortung der Gesellschaft, sich dem Geschichtsrevisionismus entgegenzustellen und sich dafür einzusetzen, dass die auf wissensbasierte Reflexion und die Würdigung der Opfer ausgerichtete Erinnerungskultur erhalten bleibt, denn auf ihr basiert unser demokratisches Wertesystem.
Veröffentlichung mit Dank an den Kölner Stadtanzeiger, der die Kolumne veröffentlicht.
Henning Borggräfe im Kölner Stadtanzeiger vom 14.12.2024
Dies ist meine letzte Kolumne in der Reihe „Brandbriefe“. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, einmal nicht über die gegenwärtige Entwicklung der extremen Rechten oder über neue antisemitische und rassistische Vorfälle zu schreiben. Stattdessen soll es um die zukünftige Entwicklung des NS-Dok als Gedenkstätte gehen, und damit um die Frage, welche Geschichte(n) wir über das EL-DE-Haus und über die Kölner Stadtgesellschaft im Nationalsozialismus erzählen.
 In Vorbereitung einer geplanten Neugestaltung der Dauerausstellung und weiterer Publikumsflächen im EL-DE-Haus beschäftigen wir uns derzeit intensiv mit der konkreten Nutzung des Gebäudes durch die Kölner Gestapo. Das Interesse an der Hausgeschichte konzentrierte sich lange Zeit auf das ehemalige Gefängnis im Keller mit den zahlreichen Wandinschriften der Häftlinge. Die darüber liegenden Büroetagen der Gestapozentrale erhielten weniger Aufmerksamkeit. Doch neben Inhaftierung, Folter und Hinrichtungen bestand das Gestapohandeln größtenteils aus bürokratischen Routinen: mit Bürgerinnen und Bürgern, Behörden und anderen Stellen kommunizieren, Akten führen, Karteien pflegen, Listen schreiben. Banal erscheinendes Verwaltungshandeln – mit oft mörderischen Konsequenzen. Seit ich vor zwei Jahren im NS-Dok angefangen habe, beschäftigt mich die Frage, was, wo im EL-DE-Haus geschah. Bisher standen wir vor dem Problem, dass sich aus zwei Mitarbeiterverzeichnissen der Gestapo für 1939/40 zwar nachvollziehen ließ, welche Zimmernummern den Büros der verschiedenen Referate zugewiesen waren. Diese Nummern ließen sich jedoch nicht den Räumen auf den Etagen und Fluren im El-De-Haus zuordnen. Durch den Fund zweier Luftschutzordnungen, in denen für einige Nummern vermerkt ist, auf welcher Etage die zugehörigen Zimmer lagen und ob die Fenster mit Holzrollos ausgestattet waren oder ob für die Verdunkelung Vorhänge angebracht werden mussten, lässt sich dieses Rätsel nun lösen – denn die alten Führungsschienen der Rollos sind noch vorhanden.
In Vorbereitung einer geplanten Neugestaltung der Dauerausstellung und weiterer Publikumsflächen im EL-DE-Haus beschäftigen wir uns derzeit intensiv mit der konkreten Nutzung des Gebäudes durch die Kölner Gestapo. Das Interesse an der Hausgeschichte konzentrierte sich lange Zeit auf das ehemalige Gefängnis im Keller mit den zahlreichen Wandinschriften der Häftlinge. Die darüber liegenden Büroetagen der Gestapozentrale erhielten weniger Aufmerksamkeit. Doch neben Inhaftierung, Folter und Hinrichtungen bestand das Gestapohandeln größtenteils aus bürokratischen Routinen: mit Bürgerinnen und Bürgern, Behörden und anderen Stellen kommunizieren, Akten führen, Karteien pflegen, Listen schreiben. Banal erscheinendes Verwaltungshandeln – mit oft mörderischen Konsequenzen. Seit ich vor zwei Jahren im NS-Dok angefangen habe, beschäftigt mich die Frage, was, wo im EL-DE-Haus geschah. Bisher standen wir vor dem Problem, dass sich aus zwei Mitarbeiterverzeichnissen der Gestapo für 1939/40 zwar nachvollziehen ließ, welche Zimmernummern den Büros der verschiedenen Referate zugewiesen waren. Diese Nummern ließen sich jedoch nicht den Räumen auf den Etagen und Fluren im El-De-Haus zuordnen. Durch den Fund zweier Luftschutzordnungen, in denen für einige Nummern vermerkt ist, auf welcher Etage die zugehörigen Zimmer lagen und ob die Fenster mit Holzrollos ausgestattet waren oder ob für die Verdunkelung Vorhänge angebracht werden mussten, lässt sich dieses Rätsel nun lösen – denn die alten Führungsschienen der Rollos sind noch vorhanden.
So wissen wir jetzt etwa, dass die Leiter der Gestapozentrale, die Organisatoren des Terrors in Stadt und Region, im 1. Obergeschoss nahe dem Treppenhaus an der Elisenstraße ihr Büro hatten – ironischerweise befinden sich dort heute die Teeküche des NS-Dok und ein WC. Die Schreibtische der Gestapo-Beamten, die die Ausgrenzung und Deportation der Kölner Jüdinnen und Juden organisierten, standen im 2. Obergeschoss am Appellhofplatz – in den Räumen der 1997 eröffneten Dauerausstellung, welche die Verfolgung und Vernichtung der jüdischen Bevölkerung thematisiert, sie aber nicht direkt mit dem Haus in Beziehung setzt.
Der Quellenfund ist deshalb so wichtig, weil bei einer Neugestaltung der Ausstellung der historische Ort erzählerisch noch stärker ins Zentrum rücken soll. Dieser Fokus wird kombiniert mit einer Geschichte der Kölner Stadtgesellschaft im Nationalsozialismus, in der das Alltagshandeln und die Erfahrungen der Bevölkerung im Mittelpunkt stehen: Wie haben sich einzelne Deutsche in der NS-Diktatur verhalten? Wie nahmen sie Ausgrenzung und Verfolgung wahr? Wie waren sie daran beteiligt? Und wie erlebten dies diejenigen, die zu Opfern der NS-Gewalt wurden? Die kritische Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus zu betreiben und zu ermöglichen, ist eine Kernaufgabe der Gedenkstätten – hierauf hat auch Jens-Christian Wagner in seiner letzten Kolumne hingewiesen. Im gegenwärtigen politischen Klima geraten die Gedenkstätten verstärkt unter Druck und werden angegriffen, wie wir in den letzten Wochen immer wieder aufgezeigt haben.
Gedenkstätten unter Druck
Diese Angriffe müssen von Politik und Gesellschaft abgewehrt werden. Zugleich müssen aber auch die Gedenkstätten ihre Ausstellungen und Vermittlungsangebote weiterentwickeln, um ihren Aufgaben in einer sich wandelnden Gesellschaft gerecht zu werden. Von Beginn an empfand ich die enge Anbindung des NS-Dok an die Kölner Stadtgesellschaft als große Stärke. Die heutige Stadtgesellschaft ist jedoch zunehmend von Menschen ohne einen engen oder auch jeglichen familiären Bezug zur Kölner NS-Geschichte geprägt. Sie schauen mit anderen Fragen und Interessen auf die NS-Zeit, als die letzte „Erlebnisgeneration“, an die sich die jetzige Dauerausstellung bei ihrer Eröffnung im Jahr 1997 noch stark richtete.
Es braucht ein neues Angebot für das historische Lernen in der postmigrantischen Stadtgesellschaft Kölns, das die kritische Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus auch zukünftig lebendig halten kann. Eine große Aufgabe, an der wir in den kommenden Jahren im NS-Dok arbeiten möchten.
Veröffentlichung mit Dank an den Kölner Stadtanzeiger, der die Kolumne veröffentlicht.
Jens-Christian Wagner im Kölner Stadtanzeiger vom 7.12.2024
In den vergangenen 30 Jahren wurden die Gedenkstätten stark ausgebaut. Mittlerweile gibt es in Deutschland rund 300 Gedenk- und Bildungsstätten, die an den Nationalsozialismus und seine Opfer erinnern. Zugleich erleben wir seit 2015 mit den Wahlerfolgen der AfD den Aufstieg einer Partei, aus deren Reihen die Gedenkstättenarbeit als „Schuldkult“ diskreditiert wird und deren Funktionäre notorisch Holocaust-Verharmlosung verbreiten. Besonders große Zustimmung fand die AfD bei den letzten Landtagswahlen bei jungen Wählerinnen und Wählern – Menschen, die vermutlich vor gar nicht allzu langer Zeit mit ihrer Schulklasse eine Gedenkstätte besucht haben.
Wie kann es sein, dass diese Leute die AfD wählen und offenbar für geschichtsrevisionistische Parolen empfänglich sind? Nun wäre es falsch, für die hohen Zustimmungswerte der extrem Rechten die Gedenkstätten verantwortlich zu machen. Der Rechtsruck in Deutschland und weltweit ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, dem sich alle stellen müssen, allen voran die demokratischen Parteien, aber auch die Unternehmen, die Gewerkschaften, die Schulen, die Medien und nicht zuletzt jeder einzelne: in der Familie, im Freundeskreis, im Betrieb, im Verein.
Zudem haben die Gedenkstätten zu Recht immer davor gewarnt, sie als demokratische Läuterungsanstalten wahrzunehmen: Niemand wird zu einem besseren Menschen und überzeugten Demokraten, nur weil er einmal eine Gedenkstätte besucht hat. Gedenkstättenbesuche sind keine Schutzimpfung gegen rechts. Gleichwohl müssen wir uns die Frage stellen, ob unsere Erinnerungskultur, auf die viele in Deutschland so stolz sind, nicht auch Defizite aufweist. Das fängt schon mit Begrifflichkeiten an: An was sollen sich eigentlich 16-jährige Schüler „erinnern“, wenn sie eine Gedenkstätte wie Buchenwald besuchen? Auf sie wirkt der Appell, sich an etwas erinnern zu sollen, was mittlerweile selbst ihre Großeltern nicht mehr selbst erlebt haben, als Überforderung, die leicht in Abwehr münden kann. Am besten wäre es, den Begriff der Erinnerung aus der Geschichtskultur zu streichen. Statt um affirmative Erinnerung geht es um Reflexion, um den kritischen Blick auf Geschichte und Gegenwart. Ein weiteres Manko unserer „Erinnerungskultur“ ist ihr Opferzentrismus. Sicherlich, im Sinne der Würdigung stehen die Opfer im Mittelpunkt, es sollen schließlich nicht die Täter geehrt werden. Aber historisch-politische Bildung muss doch nicht nur danach fragen, wer die Opfer waren, sondern auch, wer sie zum Opfer gemacht hat. Das heißt, dass nach den Tätern und Mittätern, nach den Profiteuren und den Zuschauern gefragt werden muss – und danach, wie die NS-Gesellschaft als radikal rassistisch und antisemitisch formierte „Volksgemeinschaft“ funktionierte, eine Gemeinschaft, die sich vor allem darüber definierte, wer nicht dazu gehörte und ausgegrenzt, verfolgt und am Ende vielfach auch ermordet wurde. Es gilt, sich gesellschaftsgeschichtlich mit den nationalsozialistischen Verbrechen zu beschäftigen und danach zu fragen, was die meisten Deutschen zum Mitmachen motivierte. Verheißungen der Ungleichheit und Ideologien der Ungleichwertigkeit spielten da eine große Rolle, wie auch die öffentliche Kriminalisierung der Ausgegrenzten, die der Mehrheitsbevölkerung als gefährliche Feinde präsentiert wurden.
Doch statt eines kritischen Blicks auf die NS-Gesellschaft erleben wir – weniger in der Gedenkstättenarbeit als in der normativen Rhetorik der Erinnerung – überwiegend eine Fokussierung auf die Opfer, nicht selten sogar eine Identifikation, was seitens der Post-Tätergesellschaft eine Anmaßung ist. Aber es scheint eben einfacher zu sein, mit und um Opfer zu trauern und sich damit gewissermaßen selbst moralisch zu überhöhen, als Fragen nach den Hintergründen der Verbrechen zu stellen. Solche Fragen könnten mit Blick auf die eigene Familiengeschichte auch wehtun; deswegen werden sie zu wenig gestellt. Stattdessen blendet das bloße Trauern um die Opfer alles aus, was die Verbrechen erst ermöglichte: mörderischer Rassismus, Antisemitismus und Antikommunismus, Antiliberalismus, die Unterscheidung zwischen wertvollen „Produktiven“ und wertlosen „Unproduktiven“, soziale Aufstiegsversprechungen, Nationalismus sowie Eroberungs- und Vernichtungsfantasien.
Eine derart entkontextualisierte Erinnerungskultur, die eher eine Verdrängungskultur ist, wirkt entlastend. Es ist eine Wohlfühl-Erinnerungskultur, die niemandem wehtut – außer den Opfern und ihren Angehörigen, die fühlen, dass sie instrumentalisiert werden. Am perfidesten zeigte dies im vergangenen Jahr ein Twitter-Post hochrangiger AfD-Bundestagsabgeordneter um Beatrix von Storch, die zum Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar ein Foto von sich posteten, wie sie Tafeln mit der Inschrift „#weremember“ hochhalten. Hier wurde die Entkontextualisierung auf die Spitze getrieben und das Schlagwort von der „Erinnerung“ zu einer ahistorischen Worthülse degradiert.
Das „Versöhnungstheater“, wie der Publizist Max Czollek diese Art von Erinnerungskultur nennt, müssen wir durch eine wirkliche kritische Auseinandersetzung mit der Geschichte ersetzen – wissenschaftlich fundiert und quellengestützt, sauber aus der Geschichte heraus argumentierend und zugleich immer auch mit einer in die Gegenwart gerichteten Perspektive: Wie sieht es denn heute mit Verheißungen der Ungleichheit aus oder mit Rassismus und Antisemitismus?
Eine solchermaßen erneuerte Erinnerungskultur wird die Rechtsextremen und ihre menschenfeindlichen Ideologien nicht allein zurückdrängen können. Aber sie kann helfen, Geschichtsbewusstsein und historische Urteilskraft in der Gesellschaft zu stärken – und das Bewusstsein der Menschen dafür, welche Relevanz die Auseinandersetzung mit den NS-Verbrechen für unsere demokratische Selbstverständigung und die Achtung von Demokratie und Menschenrechten hat. Das Grundgesetz regelt nicht nur das Zusammenleben der Menschen in Deutschland, sondern war 1949 auch eine Antwort auf die NS-Verbrechen. Nicht umsonst heißt es in Artikel 1: „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Die Würde des Menschen, nicht nur des Deutschen.
Veröffentlichung mit Dank an den Kölner Stadtanzeiger, der die Kolumne veröffentlicht.
Henning Borggräfe im Kölner Stadtanzeiger vom
30. November 2024
In seiner letzten Kolumne schrieb Jens-Christian Wagner über ein wichtiges Urteil des Verwaltungsgerichts Weimar zur Abweisung einer Klage der AfD gegen die Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora. Er erwähnte, dass auch Lehrer*innen aufgrund vermeintlicher Verletzungen des Neutralitätsgebots im Fokus der Partei stehen.
Passend hierzu berichtete der „Kölner Stadt-Anzeiger“ am vergangenen Mittwoch über Vorgänge im NRW-Landtag, wo die AfD in den letzten Monaten eine Reihe kleiner Anfragen zum Verhalten des Lehrpersonals an Kölner Schulen gestellt hat. Den Anlass bildeten Proteste gegen AfD-Parteitage in den Schulen, aber auch eine Nichteinladung der Partei zu einer Diskussionsrunde im Vorfeld der Europawahl.
Fragen nach der Weitergabe von Informationen über einen Parteitag in einer Schule an Eltern und Schüler*innen, nach einer möglichen Beteiligung von Lehrer*innen am „Basteln von ‚Anti-AfD‘-Plakaten“ und zuletzt sogar nach den Namen von Lehrer*innen, die an einer bestimmten schulinternen Sitzung teilgenommen hatten, zielen darauf, disziplinarrechtliche Maßnahmen gegen diejenigen zu erwirken, denen man Verstöße gegen das Neutralitätsgebot vorwirft. Eine Elterninitiative der betreffenden Schule erkennt dahinter die Absicht, diese und andere Schulleitungen und Lehrerkollegien zu verunsichern. Sie sollen nicht nur davon abgehalten werden, mit ihren Schüler*innen über solche Parteitage in den eigenen Räumen zu sprechen und die Frage der Verfassungsfeindlichkeit der Partei zu diskutieren. Selbst die bloße Weitergabe der Information über eine entsprechende Veranstaltung soll verhindert werden. Proteste im Vorfeld und am Tag selbst wären damit faktisch unmöglich.
Die Klage gegen die Gedenkstätte Buchenwald und die Anfragen im NRW-Landtag können als Beispiele für eine Strategie begriffen werden, durch das Vorgehen gegen einzelne Personen eine diskursive und praktische „Normalisierung“ der Partei herbeizuführen. Der vom Verfassungsschutz im Bund als „rechtsextremistischer Verdachtsfall“ und in einigen Bundesländern als „gesichert rechtsextrem“ eingestuften Partei geht es darum, mit ihren politischen Forderungen in der Bevölkerung als „normal“ wahrgenommen und von staatlichen oder staatlich geförderten Einrichtungen – Schulen, aber auch Gedenkstätten – wie eine demokratische Partei behandelt zu werden. „Deutschland. Aber normal“ lautete der Slogan zur Bundestagswahl 2021, der nach wie vor auf vielen Artikeln prangt, die über die Website des „Fanshops“ der AfD bestellt werden können.
Was viele Menschen in diesem Land traurigerweise für normal zu halten scheinen, macht die vor zwei Wochen veröffentlichte neue Leipziger Autoritarismus-Studie deutlich. Eine steigende Zahl von Menschen steht der Demokratie ablehnend gegenüber. Rassistische und antisemitische Aussagen finden gerade auch in West-Deutschland immer mehr Anklang. Schon seit mehreren Jahren teilen etwa 60 Prozent der Befragten die Auffassung, dass man sich „lieber gegenwärtigen Problemen“ widmen solle, statt der Auseinandersetzung mit der NS-Zeit. „Und 17 Prozent hielten es – trotz oder vielleicht auch wegen des NS-Vokabulars in der vorformulierten Aussage – für eine gute Idee, wenn es in Deutschland „eine einzig starke Partei“ gäbe, „die die Volksgemeinschaft insgesamt verkörpert. Weitere 21 Prozent stimmen dieser Aussage wenigstens teilweise zu
Dieses politische Klima bleibt nicht ohne Auswirkungen auf die Erinnerungskultur zu Nationalsozialismus und Holocaust und damit auch auf die Gedenkstätten. Das zeigen auch die jüngsten Vorfälle aus Köln: Über die Kommentarfunktion zum digitalen Gedenkbuch der jüdischen Opfer des Nationalsozialismus auf der Website des NS-Dokumentationszentrums, die dazu gedacht ist, Wissen zu teilen, erhielten wir kürzlich extrem beleidigende Nachrichten, in denen einzelne Ermordete herabgewürdigt und ihr Tod belacht wurde. Und am Kölner Hauptbahnhof wurde in der vergangenen Woche das Mahnmal „Die Schwelle“, das an die Deportation der Juden unter der Mitwirkung der Reichsbahn erinnert, aus der Verankerung gerissen und so stark be-schädigt, dass es vorerst abgebaut werden musste.
Angesichts dieser Gesamtsituation ist es umso wichtiger, dass die Gedenkstätten in Deutschland, die mit öffentlichen Mitteln gefördert werden oder – wie das NS-Dok – selbst Teil der öffentlichen Verwaltung sind, sich durch das Urteil des Verwaltungsgerichts Weimar darin bestärkt sehen können, sich auch politisch zu äußern, wenn es den Kern der eigenen Arbeit betrifft.
Veröffentlichung mit Dank an den Kölner Stadtanzeiger, der die Kolumne veröffentlicht.
Jens-Christian Wagner im Kölner Stadtanzeiger vom 23.11.2024
Systematisch versucht die AfD, Beschäftigte im öffentlichen Dienst, die sich gegen ihre rassistischen und geschichtsrevisionistischen Parolen positionieren, mit Verweis auf das parteipolitische Neutralitätsgebot einzuschüchtern und zum Schweigen zu bringen. Das gilt etwa für Lehrerinnen und Lehrer, auf die auf von der Partei eingerichteten Meldeportalen aufmerksam gemacht werden soll, wenn sie sich gegen die AfD geäußert haben.
Auch Beschäftigte von Gedenkstätten versucht die AfD immer wieder mit Verweis auf das Neutralitätsgebot einzuschüchtern und von einer klaren Haltung gegenüber ihren geschichtsrevisionistischen und Holocaust-verharmlosenden Positionen abzubringen. Diese Versuche hat das Verwaltungsgericht Weimar nun erfreulich deutlich zurückgewiesen: Es schreibt, die Gedenkstätten seien „berechtigt, in aktuelle Diskussionen zu den Opfern, deren in den Gedenkstätten (…) gedacht wird, einzutreten und selbst zu allen Fragen im Zusammenhang mit den Opfern und zu der Gestaltung der Erinnerungsarbeit Stellung zu nehmen.“ Dabei dürften sie „auch Äußerungen Dritter, die das Gedenken und Erinnern an die Opfer berühren, bewerten und einordnen. Eine solche Einordnung kann nicht neutral erfolgen, sondern setzt das aktive Eintreten für die Opfer voraus.“
Und weiter: „Aus dem Stiftungszweck ergibt sich die Befugnis der aktiven Ausgestaltung des Gedenkens in Form der sachlichen Einordnung und Bewertung politischer Äußerungen, die einen Bezug zu der Würde der Opfer haben.“ Gedenkstätten seien „die Stimme der Opfer, die selbst nicht mehr aktiv an der Erinnerungsarbeit teilnehmen können“ (Beschluss des VG Weimar vom 6.11.2024, AZ: 8 E 1652/24 We).
Anlass war die Klage der AfD gegen einen Brief, den die Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora vor der Landtagswahl als Postwurfsendung an ältere Bürgerinnen und Bürger in Thüringen geschickt hatte. Das Schreiben informierte sachlich darüber, wie die Thüringer AfD systematisch versucht, die Schrecken des Nationalsozialismus kleinzureden, die NS-Sprache wieder salonfähig und die Erinnerungskultur verächtlich zu machen.
Unmittelbar nach der Verteilung der ersten Briefe setzte über Social Media eine Desinformationskampagne der Thüringer AfD ein. Dabei wurde wahrheitswidrig behauptet, die Stiftung habe für den Brief Steuermittel missbraucht, sie habe gegen den Datenschutz verstoßen (indem sie sich illegal die Adressen der älteren Thüringer beschafft habe) und sie habe gegen das Neutralitätsgebot verstoßen. Tatsächlich wurden für die Verteilung der Postwurfsendung in einer Auflage von 350.000 Stück in ganz Thüringen ausschließlich Spendenmittel des Vereins campact verwendet, der auch den Versand über die Deutsche Post organisierte. Letztere hat pauschalisierte Verteiler zu Haushalten angenommener bestimmter Zielgruppen; in diesem Fall die Gruppe Ü 65 in Thüringen. Folge der Desinformation der AfD war ein „Shitstorm“ von beschimpfenden Emails, Anrufen und analogen Schreiben, die die Stiftung und ihre Mitarbeiter:innen erreichten. Dazu gehörten auch mehrere Mails bzw. Briefe mit Morddrohungen gegenüber dem Stiftungsdirektor („ein Galgen, ein Strick, ein Wagnergenick“). Und es ging eine Klage der Thüringer AfD beim Verwaltungsgericht Weimar auf Unterlassung ein. Diese Klage hat das Gericht nunmehr im Grundsatz zurückgewiesen. Lediglich einen Halbsatz in einem erläuternden Text zum Wahlbrief, den die Gedenkstättenstiftung auf ihrer Website veröffentlicht hatte und der als Aufruf verstanden werden kann, die AfD nicht zu wählen, wurde beanstandet und musste gelöscht werden.
Den eigentlichen „Wahlbrief“ mit dem Hinweis auf geschichtsrevisionistische und gegen die Gedenkstättenarbeit gerichtete Positionen aus der AfD befand das Gericht hingegen als sachlich zutreffend und rechtskonform. Solche Positionen sind nicht zuletzt gegen den gesetzlich definierten Zweck der vom Land Thüringen errichteten Gedenkstätten-Stiftung gerichtet. Deshalb, so bestätigte das Gericht, kann es hier keine Neutralität geben; vielmehr leitet sich aus dem Stiftungsgesetz die Verpflichtung ab, die Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora und die Opfer der NS-Verbrechen gegenüber solchen Angriffen zu schützen.
Für die Gedenkstätten in Deutschland ist der Gerichtsbeschluss eine gute Nachricht. Er bestätigt ihre gesellschaftspolitischen Aufgaben, zu denen grundsätzlich gehört, die Würde der NS-Opfer zu schützen und ein kritisches historisches Bewusstsein in der Gesellschaft durch historisch-politische Interventionen zu stärken – ganz explizit auch, indem sie in aktuelle politische Debatten eingreifen.
Es ist bezeichnend, wenn die AfD versucht, die Wirkungsfähigkeit der Gedenkstätten einzuschränken und ihre Leitungen einzuschüchtern – übrigens auch mittels einer Kleinen Anfrage der AfD-Fraktion im Bundestag vom 2. September 2024, die der Leitung der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora „fortlaufend undemokratisches Verhalten“ unterstellt). Demgegenüber kann man nicht oft genug betonen: Eine KZ-Gedenkstätte kann nicht unpolitisch sein; sie muss ihre Stimme erheben, wenn Geschichte verfälscht und die Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus missachtet wird. Gegenüber der Holocaust-Verharmlosung gibt es für Gedenkstätten – wie auch für jeden Menschen, der auch nur einen Funken Moral und Anstand besitzt – keine Neutralität. Das hat das Verwaltungsgericht Weimar nun ausdrücklich bestätigt.
Veröffentlichung mit Dank an den Kölner Stadtanzeiger, der die Kolumne veröffentlicht.
Henning Borggräfe im Kölner Stadtanzeiger vom
16. November 2024
Die vorvergangene Woche stand in Köln im Zeichen des Gedenkens an die NS-Verfolgten. Sie war zugleich wieder einmal geprägt von Ereignissen außerhalb der Stadt, die Kopfschütteln und Fragezeichen hinterlassen. Die Auseinandersetzung mit der Geschichte des Nationalsozialismus und mit gegenwärtigen Herausforderungen kennzeichnet das Profil des NS-Dok. Und doch ist es mitunter schwierig, mit der Gleichzeitigkeit umzugehen. Leben wir in Köln – wie ich in Gesprächen immer wieder höre – auf einer Insel der Seligen, wenigstens, was die politische Lage angeht? Oder sehen viele nur nicht, welche Entwicklungen sich schon vollziehen und abzeichnen?
Am Dienstag verlegten die Kolleg*innen mit dem Künstler Gunter Demnig und engagierten Bürger*innen zahlreiche neue Stolpersteine. Angehörige jüdischer ehemaliger Kölner*innen waren für die Verlegungen angereist, suchten anschließend im NS-Dok den Austausch und sahen Quellen zur Familiengeschichte ein. Währenddessen flog in Sachsen, Jens-Christian Wagner hat hierüber geschrieben, die nächste mutmaßliche rechte Terrorgruppe auf, deren personelle Verbindungen zum AfD-Jugendverband „Junge Alternative“ kaum mehr überraschen. Mittwochvormittags sprachen wir im Vorstand des Verbands der Gedenkstätten in Deutschland über den jüngsten Entwurf zur Neufassung der Gedenkstättenkonzeption des Bundes, die in dieser Legislaturperiode verabschiedet werden sollte. Nachmittags bereiteten wir im NS-Dok die Verlängerung des Projekts der „Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus“ vor, das aus Bundesmitteln kofinanziert wird. Abends platzte die Koalitionsregierung in Berlin und ich fragte mich nicht nur, welche Auswirkungen dies auf das haben wird, woran wir tagsüber gearbeitet hatten, sondern auch, was baldige Neuwahlen für das Risiko eines weiteren Erstarkens der extremen Rechten bedeuten werden.
Am Donnerstagabend feierten wir im NS-Dok die Verleihung des Bilz-Preises an die Initiative „Stimmen der Solidarität“, die sich mit bewundernswerter Ausdauer für politisch Inhaftierte in der Türkei und im Iran einsetzt. Beim Empfang kreisten viele Gespräche um die Ereignisse des Vorabends und die Auswirkungen vorgezogener Bundestagswahlen mit Blick auf die AfD. Kurze Zeit später wurden in Amsterdam am Rande eines Fußballspiels Juden von sogenannten propalästinensischen Demonstranten angegriffen und durch die Straßen gejagt.
Freitagvormittags die Gedenkveranstaltung zum Jahrestag der Pogromnacht in der Synagoge Roonstraße. Schüler*innen stellten in eindrucksvollen Beiträgen Biografien verfolgter Kölner Jüdinnen und Juden vor und reflektierten in Gedichten über die Erinnerungskultur. Abraham Lehrer, Vorstandsmitglied der Synagogen-Gemeinde Köln, fand klare Worte zu den Vorfällen in Amsterdam und zur politischen Lage hierzulande. Der Alltag vieler Kölner Jüdinnen und Juden ist angesichts unzähliger antisemitischer Vorfälle in Deutschland und Europa weit von Normalität entfernt. Gemessen am Vorjahr war die Beteiligung der Kölner Stadtgesellschaft am Gedenken eher gering. Dies war hoffentlich der außergewöhnlichen Uhrzeit geschuldet und kein Zeichen dafür, dass die Solidarität mit der jüdischen Gemeinde ein Jahr nach dem mörderischen Terror der Hamas gegen Israel deutlich nachgelassen hat.
Zum Wochenabschluss fand am Sonntag das Gedenken zum 80. Jahrestag der zweiten öffentlichen Hinrichtung in Ehrenfeld am 10. November 1944 statt. Ohne ein Gerichtsurteil ermordete die Gestapo damals mitten in der Stadt am helllichten Tag 13 Männer und Jugendliche. Viel gäbe es zu schreiben, über den langen Streit um die Einordnung dieser Tat und die Anerkennung der Ermordeten, über die stigmatisierende Bezeichnung von NS-Opfern als „Kriminelle“, was eine jahrzehntelange Ausgrenzung zufolge hatte, aber auch über den Begriff „Widerstandskämpfer“, der vermeintlich Klarheit suggeriert, wo es darum gehen müsste, Graubereiche und Ambivalenzen auszuleuchten. Doch die aktuellen politischen Ereignisse nehmen derzeit gedanklich und in Gesprächen viel Raum ein und es erscheint mir falsch, auf diese Gleichzeitigkeit nicht einzugehen.
Veröffentlichung mit Dank an den Kölner Stadtanzeiger, der die Kolumne veröffentlicht.
Jens-Christian Wagner im Kölner Stadtanzeiger vom 9.11.2024
Angesichts der Wahl in den USA und des Bruchs der Ampel-Koalition in Berlin ging die neueste Nachricht zur AfD in dieser Woche etwas unter: Am Dienstag nahm die Polizei in Sachsen und in Polen auf Anweisung der Bundesanwaltschaft acht Mitglieder der mutmaßlichen Terrorgruppe „Sächsische Separatisten“ fest. Dabei wurden Waffen und Munition sichergestellt. Die Gruppe, deren Abkürzung „SS“ offenbar ganz bewusst in Analogie zu Himmlers „Schutzstaffel“ genutzt wurde, plante für einen „Tag X“, bewaffnete Milizen als „arische Schutztruppen“ loszuschicken, um systematisch Andersdenkende und Nichtdeutsche zu töten. Nach „Spiegel“-Informationen soll dabei auch das Wort „Holocaust“ gebraucht worden sein.
Zu der Terrorgruppe gehörten offenbar mindestens drei AfD-Mitglieder, darunter Kurt Hättasch, Mitglied des Stadtrates in Grimma und Schatzmeister der sächsischen Jungen Alternative, des Jugendverbandes der AfD. Er galt in der Partei als vielversprechendes Talent und soll bei seiner Festnahme mit einem Gewehr bewaffnet gewesen sein und sich verbarrikadiert haben; ein Polizist gab Schüsse ab.
Hättasch ging zuvor durch die Ideologieschule des „Instituts für Staatspolitik“ in Schnellroda in Sachsen-Anhalt. Geleitet wird dieses vor kurzem formal ausgelöste Institut von Götz Kubitschek, einem der Vordenker der Neuen Rechten und Chefredakteur der „Sezession“, einer rechtsextremen Zeitschrift, die auch in der AfD gerne gelesen wird. Neben Mitgliedern der „Identitären Bewegung“ und der Jungen Alternative ist auch der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke gerngesehener Gast in Schnellroda. Kubitschek ist so etwas wie sein ideologischer Einflüsterer. Nach eigenen Angaben saß Kubitschek am Abend der Landtagswahl in Thüringen lange mit Höcke zusammen und plante das weitere Vorgehen der AfD, die in Thüringen vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft wurde und bei der Wahl fast ein Drittel der Wählerstimmen erhielt.
Der Fall der „Sächsischen Separatisten“ macht erneut deutlich, welche Gefahr von der AfD ausgeht – auch wenn sich die Partei jetzt bemüht, sich von den Festgenommenen zu distanzieren. Im vergangenen Jahr hatte das BKA bereits eine andere mutmaßliche Terrorgruppe festnehmen lassen, die Reichsbürgertruppe um Heinrich XIII. Prinz Reuß. Mitglied der Gruppe war die frühere AfD-Bundestagsabgeordnete Birgit Malsack-Winkemann. Zum Umfeld der Gruppe gehörte zudem der Thüringer Aktivist Frank Haußner, ein Duzfreund von Höcke. Die Verbindungen der AfD in das „patriotische Vorfeld“, wie Höcke es nennt, sind vielfältig. Dazu zählen die Reichsbürgerszene, Putin-Anhänger, Pandemieleugner, „Freie Sachsen“ und „Freie Thüringer“ bis hin zu Neonazis aus Gruppierungen wie dem „Dritten Weg“ und anderen. Etliche von ihnen sind als gewalttätig einzustufen.
Die AfD ist tatsächlich so etwas wie der starke parlamentarische Arm dieser potenziell gewalttätigen und recht heterogenen rechtsextremen Szene. Unter dem in Schnellroda entwickelten Schlagwort vom „solidarischen Patriotismus“ verbreitet die AfD Verheißungen der Ungleichheit und redet Ideologien der Ungleichwertigkeit das Wort. Politische Gegner entmenschlicht sie, indem sie sie als „Feinde“ markiert. Ständig hetzt sie gegen die Parteiendemokratie. 2023 raunte Höcke in Weimar, in Zukunft könnte die Parteiendemokratie durch altgermanische Thing-Versammlungen abgelöst werden. Die Gleichberechtigung der Geschlechter wird von AfD-Funktionären in Frage gestellt; Menschen mit Behinderungen will sie ausgrenzen und „Produktive“ gegen „Unproduktive“ stellen. Auch in die vom Grundgesetz garantierte Freiheit von Kunst und Wissenschaft greift die AfD immer wieder ein. Zudem verbreitet sie notorisch Geschichtsrevisionismus und würdigt NS-Opfer herab.
All dies sind Positionen, die gegen das Grundgesetz verstoßen und gegen die freiheitlich-demokratischen Grundordnung gerichtet sind. Und die AfD hat die Mittel und den Willen, diese Positionen auch durchzusetzen. Dabei setzen AfD-Mitglieder, wie der jüngste Fall aus Sachsen zeigt, auch auf Gewalt. Ohne Zweifel ist sie eine Partei, die die liberale, plurale Demokratie bekämpft und durch einen autoritären, völkischen Staat ersetzen möchte. Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat sind deshalb aufgefordert, ein Verbot der AfD, die offen rechtsextrem und verfassungswidrig auftritt, nun endlich ernsthaft juristisch zu prüfen.
Das Argument, man missachte mit einem Verbotsverfahren 30 Prozent der Wähler:innen im Osten, ist nicht stichhaltig. Nach dieser Argumentation hätte das Bundesverfassungsgericht 1952 auch nicht die neonazistische Sozialistische Reichspartei (SRP) verbieten dürfen, die in manchen Gegenden Niedersachsens ähnlich stark war wie die AfD heute in Thüringen. Tatsächlich beendete das SRP-Verbot eine virulente Gefahr für die junge und fragile Demokratie in Westdeutschland.